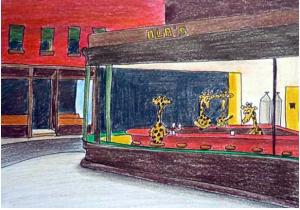Diesen Text erhielt ich nach dem IIT in der Schweiz 2009. Danke an Jens, der ihn mir weiter geleitet hat.
Y.
Von Bill Idol
Vor kurzem wurde ich zum zweiten Mal entlassen…
Das erste Mal passierte es bei einem Belegschaftsabbau im Rahmen einer Fusion. Innerhalb von sechs Monaten stellte die Firma mich wie-der an. Ein Jahr später ging es dem Geschäftsbereich schlecht, und wiederum erfuhr meine Laufbahn eine unfreiwillige Richtungsänderung, dieses Mal aufgrund einer Kostensenkungsmaßnahme.
Ich bin einer von vielen…
Ich mag als etwas begriffsstutzig erscheinen, wenn man bedenkt, dass ich nach der ersten Entlassung zurückgegangen bin. Vielleicht bin ich das auch. Jetzt aber möchte ich mich zu etwas anderem äußeren. Ich bin nur einer von vielen in den Vereinigten Staaten, die schon entlassen worden sind. Das Gesundschrumpfen – wie man es beschönigend bezeichnet – ist heutzutage durchaus üblich. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist in Unordnung, und das Gesundschrumpfen ist nur eines von vielen Symptomen dafür; ein Symptom, das Angst, Ärger und ein tiefes Misstrauen in der Organisationswelt erzeugt. Ein schmerzhafter Vorgang. Viele Gelehrte, Psychologen und Wirtschaftsbeobachter haben es zur Kenntnis genommen und sich darüber verärgert.
Natürlich bin ich verärgert und verletzt…
Den Arbeitsplatz zu verlieren, macht nicht gerade Spaß. Ein Arbeitsplatzverlust ist in jeder Stressliste immer hoch eingestuft. Die Anpassung fällt schwer, selbst wenn man es gelernt hat, mit den wirtschaftlichen, privaten und psychologischen Sorgen zurechtzukommen. Dabei ist eine der primären und stärksten Emotionen der Ärger – Ärger gegen die Organisation. Ich habe die Nachricht meiner Entlassung zunächst mit sehr großem Ärger aufgenommen, und dieser ganze Ärger richtete sich gegen die Firma und natürlich auch gegen die Überbringer der Botschaft und die Geschäftsführung. Andererseits zehrt Ärger viel Kraft auf. Es ist ein unangenehmes Gefühl und außerdem ziemlich sinnlos. Ärger beeinträchtigt auch das Bewusstsein bei weitem sein negativster Aspekt. Ärger verhindert ein ausgewogenes Urteil und sinnvolles Vorgehen.
Gründe, aus denen Ärger gegen ein Unternehmen entsteht, sind: Das Unternehmen spielt seine Macht gegen Dich aus. Es ist einfach gefühllos. Es weiß, dass es Menschen beeinträchtigen und Angst verursachen wird, schiebt die Menschen aber dennoch zur Seite. Es ist eigensüchtig, grausam und feindselig. Skrupellosigkeit ist sein Markenzeichen. Einzelne Mitarbeiter sind verwundbar, weil sie sich hingegeben haben. Die meisten von uns gehen eine Verpflichtung ein, die für uns eine Bezie-hung darstellt. Mit dem Entlassenwerden ist somit ein Gefühl der Wut, Erniedrigung und Hilflosigkeit verbunden. Es ist wie ein Schatten, lässt sich nicht vermeiden.
Die eigentliche Frage ist aber der Zustand der Organisationen…
Wenn wir aber lediglich unseren eigenen Schmerz und die psychologische Belastung spüren, entgeht uns eine größere Frage, die letztendlich auch wichtiger ist. Diese Frage betrifft den Zustand der Organisationen – nicht nur der Organisationen in den Vereinigten Staaten, sondern der Organisationen weltweit. Ich war der Leiter der Management- und Organisationsentwicklung, kurz MOD, und es gehörte zu meinen Aufgaben, das Unternehmen zu beobachten und zu versuchen, zu einem sinnvollen Unternehmensverhalten beizutragen. Ich bin davon überzeugt, dass Organisationen mehr Sympathie brauchen als ich – auch mehr mitfühlende Unterstützung. Es geht hier um die psychologische Entwicklung der Organisationen, nicht um die meinige, auch nicht um die der vielen, die mit mir das gleiche Schicksal teilen.
Ein Belegschaftsabbau ist eine besonders qualvolle Form von Bestrafung. Hier kommt einem die Herde in den Sinn, die das verletzte Mitglied im Stich läßt. Jerry Harvey, Professor an der George Washington University, schrieb einen Artikel mit dem Titel “Getting Eichmann Out of the Organization“ (Eichmann aus der Organisation verbannen) und deutet auf Ähnlichkeiten zwischen dem Holocaust und einen Belegschaftsabbau hin. Der Holocaust war die Lösung des “Jüdischen Problems“, eine geradezu verrückte Vorstellung. Der Belegschaftsabbau ist eine Lösung für ein vorgestelltes “Kopfzahlproblem“. Die eigentliche Anmaßung, dass Menschen durch die Organisation inkonsequent verschlungen werden können, trifft aber auf beide Fälle zu und unterscheidet sich nur in der Form. Der Holocaust war extrem brutal und mörderisch und wie schon erwähnt auf jeden Fall irrsinnig. Ein Belegschaftsabbau ist verglichen damit eine zahme Maßnahme: Gesetzlich, allgemein anerkannt, normal, aber trotzdem auf andere und subtilere Art brutal. In beiden Fällen zie-hen aber die von dem Problem Betroffenen verärgert den Schluss, die Organisation wisse es besser. Oder sollte es besser wissen. Oder a-ber die Organisation sei völlig übergeschnappt und gefährlich.
Organisationen wissen es einfach nicht besser…
Ich bin nicht davon überzeugt, dass es Organisationen besser wissen. Die meisten Organisationen, die ich kenne – insbesondere die großen – sind einfach auf einfältige Art dumm. Es gibt Ausnahmen, aber nicht viele. Organisationen haben, worauf bereits Carl Jung hinwies, eine Rindermentalität. Einige beschmutzen sich immer noch selbst. Wer, außer den Primitiven, Geisteskranken oder Gehirngeschädigten, würde sich schon selbst zerstören? Die Grundlage für einen Belegschaftsabbau ist, dass die Organisation ihre Mitarbeiter nicht als eigenen Bestandteil sieht. In der Regel nehmen sich Organisationen selbst überhaupt nicht wahr, und wenn sie es doch tun, so empfinden sie Mitarbeiter als von sich selbst getrennt. Es gehört nicht zu den Zwecken von Organisationen, sich für das Leben der Mitarbeiter zu engagieren und dieses zu bereichern. Die üblichen Lebensabläufe auf diesem Planeten entgehen ihrem Bewusstsein. Organisationen handeln auch häufig so, als ob sie nicht Teil der Umwelt wären. Sie plündern, vergiften und verschmutzen genau die Luft und Erde, von der sie leben. Daraus kann nur gefolgert werden, dass ihr Bewusstsein nicht so weit entwickelt ist, dass sie auch nur die einfachen Wahrheiten begreifen, die jedem einzelnen klar sind. “Natürlich, Du Idiot. Wir konntest Du auch nur glauben, Deine Beschäftigten gehörten dazu?“ Genauso, wie wenn man ein Schwein ausschimpft.
Organisationen sind Babies in der Entwicklung…
Organisationen sind lebende Systeme. Sie sind Fortsätze des menschlichen Bewusstseins und tragen all dessen Merkzeichen. Andererseits sind sie nicht sehr weit entwickelt. Man betrachte, wie jung Organisationen sind. Der Mensch selbst ist nur wenige Millionen Jahre alt, und Organisationen entstanden erst, als die Sumerer ca. 6000 Jahre vor Christus den Ackerbau organisierten.
Dieses so zu sehen, fällt vielen Menschen schwer, weil sie glauben, Organisationen seien entwickelter als sie selbst. Organisationen machen einen entwickelteren Eindruck. Aktiengesellschaften und Institutionen können groß, mächtig, reich und manchmal sogar ausgesprochen angesehen sein. Viele sind älter als ihre Mitarbeiter, manchmal sogar viel älter. Man glaubt leicht, weil sie alt seien, seien sie auch weise, gerecht und gütig. Organisationen schaffen auch einige ziemlich wunder-bare Sachen. Ohne sie fehlten uns Musik, Literatur, Konsumgüter, Verteilungssysteme, kurz gesagt, wir hätten keine Zivilisation.
Babies verstehen nichts von Reziprozität…
Wir haben unsere gesamte Zivilisation auf Organisationen aufgebaut und diesen Macht über uns gegeben. Menschen, die für Organisationen arbeiten, verleihen diesen damit eine gewaltige Macht über das eigene Leben im Austausch für einen Grad an Sicherheit – gemessen in Geld – und die Möglichkeit, in produktiver Arbeit mit anderen zu partizipieren. Implizit erwartet der einzelne als Gegenleistung einer Organisation Reziprozität. Nachdem er Loyalität einbrachte, erwartet er diese als Gegenleistung von einem System, das er für intelligent genug hält, die Imp-likationen und Feinheiten des Arrangements zu verstehen. Dieser Erwartung wird in den meisten Fällen nicht entsprochen, bei den Unter-nehmen der Vereinigten Staaten immer weniger.
Babies brauchen Mitgefühl und Fürsorge…
Da Organisationen so jung sind und so generell, verglichen mit den Menschen, zurückgeblieben, ist Mitgefühl ein zweckmäßigeres Entwick-lungsmittel als Angriff und Ärger. Wir Menschen sind selbst noch nicht besonders weit entwickelt, zumindest wissen wir aber, dass ein Hund, den man schlägt, ein böser Hund wird, und dass die Misshandlung von Kindern Kindesmisshandler zur Folge hat. Mitgefühl ist ein wirksameres Mittel, Wandel und Wachstum herbeizuführen, als Ärger und Angriff, da Ärger nur Abwehr bewirkt, nicht Korrektur. Wir haben die Hexenverbrennung aufgegeben. Wir. werfen Arme nicht in den Kerker. Wir haben etwas gelernt. Historisch gesehen haben optimistische und mitfühlende Urteile über Menschen nicht stets vorgeherrscht. Es ist noch nicht lange her, dass der Behinderte als hilflos und unfähig zu einem sinnvollen Beitrag angesehen wurde. Fortschrittliche Menschen erklärten aber: “Nicht so. Dadurch muß ein Mensch nicht unbedingt nutzlos für sich selbst oder andere sein“. Gruppen und einzelne begannen, sich zu interessieren, zu unterrichten, Hilfsmittel bereitzustellen, Forschungen durchzuführen usw. In modernen Gesellschaften gilt diese altruistische Einstellung für jede Form menschlicher Behinderung. Die optimistische Meinung über die Natur des Menschen setzt sich mit der Zeit im-mer durch. Was können Religionen, Gerechtigkeit und menschliche Gleichheit sein, wenn nicht die Erkenntnis, dass das Leben durch Mitgefühl und echte Fürsorge gestärkt und verbessert wird? Was sonst sind Erziehung, Medizin und all die anderen humanen Leistungen, die wir einander bieten?
Das Überleben des Tüchtigsten ist nicht die ganze Antwort…
Rein von der Evolution her gesehen ergibt es keinen Sinn, die blind, lahm oder gehirngeschädigt Geborenen zu retten. Sie sind genetisch schwach. Sie zu retten, beinhaltet u.a. die Möglichkeit der Reproduktion. Und das geschieht auch. Ein schwaches Glied zu retten, widerspricht der Vorstellung, dass nur der Tüchtigste überleben sollte. Es ergibt aus dieser Sicht auch keinen Sinn, Kranke zu heilen oder Alte und Schwache zu pflegen. Weniger weit entwickelte Tiere tun dies nicht, der Mensch macht es aber. Und je weiter er sich entwickelt, desto ausgeprägter, nicht weniger verhält er sich so. Als wir die Lehre vom Überleben des Tüchtigsten aufnahmen, hätten wir eigentlich von der Logik her den Altruismus wie eine heiße Kartoffel fallen lassen müssen. Es müssen also noch andere Kräfte im Universum wirksam sein. Das Überleben des Tüchtigsten kann nicht die ganze Antwort sein. Es muß so sein, dass das menschliche System seine Intelligenz, Adaptation und Überle-benswürdigkeit durch angewandtes und bewusstes, altruistisches Mitgefühl steigert.
Mitgefühl heißt, die Organisation zu lehren…
Was Organisationen anbelangt, ist aber deren Unwissenheit von diesem höheren Prinzip ein Indiz für die kurze Evolutionszeit und unterentwickeltes Bewusstsein. Man bemerkt nicht, dass Organisationen mit-fühlend seien. Sie wissen nicht, wie sie es sein sollen. Es bringt daher nichts, eine Organisation anzugreifen in der Annahme, sie sei gescheit genug, um mitfühlend zu sein, sei. aber statt dessen lieber absichtlich und hochgradig grausam. Der Punkt ist das “Lehren“. Für diese Perspektive verwende ich den Ausdruck Organisationsmitgefühl (“Organizational Compassion“). Nicht Mitgefühl seitens der Organisation für irgend jemanden oder irgend etwas, vielmehr Mitgefühl für die Organisation seitens derjenigen, die weiterentwickelt sind und in der Lage, die offenkundige Unvollkommenheit der Organisation zu erkennen und diese Einsicht für einen höheren Zweck zu nutzen.
Engagement und Verantwortungsbewusstsein…
Organisationen haben einen niedrigeren Entwicklungsstand als ihr Personal. Der Eindruck, dass Organisationen hochintelligent sind, ist das Ergebnis einer Verwechslung der verschiedenen Ebenen von Lebenssystemen. Die Individuen schauen sich in ihren Organisationen um und sehen scharfsinnige, engagierte Menschen. Einige dieser Personen haben einen brillanten Geist und sind zu Recht betrübt angesichts des Zustands, in dem sich das “System“ befindet. Die Leute sehen ihre Vorgesetzten, die zu einem großen Teil genauso einsichtig und enga-giert sind, wie sie selbst, Vorgesetzte, die sie als Führungskräfte akzep-tieren; diese Leute begehen den Fehler zu glauben, dass das, was sie auf der Ebene des einzelnen sehen, automatisch und untrügerisch auch für die nächste Ebene von Systemen, d.h., die Organisation gilt. Dies ist jedoch nicht korrekt.
Was der einzelne in den Angestellten und in anderen am Unternehmen beteiligten Personen verkörpert sieht, ist die mögliche Entwicklung des Unternehmens, nicht aber sein aktueller kinetischer Zustand, der stets weniger entwickelt und manchmal sogar sehr viel weniger entwickelt ist; dies hängt ab von der Umgebung, der Verfügbarkeit von Ressourcen, der Struktur, dem Alter, dem Zeitalter und der Erfahrung. Auch der Mensch nutzt nur einen Bruchteil seines verfügbaren geistigen Potentials. Keiner von uns schöpft die gesamte Kapazität seines Gehirns aus. Wir wissen noch nicht, wie wir das tun sollten. Im Vergleich zum Menschen verstehen es Organisationen noch weniger, ihr Potential zu nutzen.
Und sie sind nicht besonders intelligent – und doch…
Es ist falsch zu glauben, dass eine Organisation so intelligent ist wie ihre intelligentesten Personen; dies ist genauso falsch wie die Annahme, man müsse nur genug intelligente Leute an einem Ort zusammen-bringen, und die Gruppe in ihrer Gesamtheit wird sofort und auf wundersame Weise intelligent. Das Verhalten des Pöbels beweist das Gegenteil. Auch wenn Organisationen und der Pöbel nicht dasselbe sind, muss mehr geschehen, als nur Menschen zusammenzubringen. Man benötigt eine Struktur und Subsysteme, um das Potential organisieren, verwalten, verbreiten und einsetzen zu können. Dies ist es, was im wesentlichen eine Organisation ausmacht. Aber eine Organisation muss geplant, entwickelt und anschließend in der konkreten, realen Welt ent-sprechend in die Tat umgesetzt werden. Danach muss sie eine Weile überleben und aus ihren Erfahrungen lernen.
Aber sie entwickeln eigene Lebensformen…
Eine Organisation lebt. Sie muss durch den Entwicklungsprozess weise und wohlwollend werden. Organisationen reifen wie edler Wein. Traubensaft, und stammte er auch von den edelsten Trauben, kann nicht durch Befehle dazu gebracht werden, hervorragender Wein zu werden. Wenn eine Organisation eine Maschine oder ein lebloser Gebrauchsgegenstand wäre, könnte man sie binnen kurzer Zeit durch Austauschen oder Hinzufügen von Teilen reparieren. Eine Organisation ist jedoch keine Maschine. Eine Organisation ist eine Lebensform.
Die Lebensform einer Organisation stimmt jedoch nicht mit der Lebens-form der Individuen überein, die die Organisation bilden. Sie trägt die psychologischen Merkmale aller Individuen, vor allem die ausgeprägtesten Merkmale. Aber diese einzelnen Merkmale oder Kennzeichen werden im Laufe der Zeit abgeschwächt, vor allem in großen Organisationen. Wer weiß es – und wen interessiert es -‚ dass Andrew Carnegie ein hervorragender Frachtführer der Pennsylvania Railroad war? Was eine Person vor Jahren tat, ist in großen Systemen im allgemeinen nicht erkennbar. Wenn die Organisation lange genug lebt, entwickelt sie sich ganz allmählich zu einer eigenständigen Person.
Organisationen beginnen, für sich selbst zu denken…
Eine Organisation ist ein neues Lebewesen – ein Lebewesen, das sich auch je nach seiner Bestimmung und seinen Anlagen entfalten, entwickeln und sich anpassen muss. Es gibt einen Punkt – obwohl noch niemand genau weiß, woran man ihn erkennen kann -‚ an dem eine Organisation beginnt, für sich selbst zu denken. Wie jedes andere Lebewesen auch, beginnt sie auf einer relativ einfachen, rudimentären Stufe und entwickelt dann im Laufe der Zeit und aufgrund ihrer Erfahrungen eine Vielgestaltigkeit an Struktur und Gedanken. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass die Organisation als äußerst hochentwickelter Ausdruck eines äußerst hochentwickelten Organismus beginnt: dem Menschen. Auch wenn in unserem Zeitalter die durchschnittliche Organisation keineswegs so intelligent ist, wie ihr intelligentester Mensch, so ist eine Organisation doch ein komplexeres. System als ein einzelnes In-dividuum, und sie trägt in sich das Potential, intelligenter zu werden, als irgendeine Person in ihr.
Die Intelligenz bringt die Zeit zum Einstürzen…
Vergleichen Sie einmal den Evolutionszeitraum, der für die Planung und Entstehung eines Adlers und einer Boeing 747 benötigt wurde. Die natürliche Evolution des Adlers findet bereits seit Millionen von Jahren statt. Die Boeing 747, die schneller, höher und weiter fliegt als der Adler, wurde in einem Zeitraum von nur 70 Jahren entwickelt, wenn man bis ganz zurück zu den Gebrüdern Wright geht Mit Hilfe der organisierten Intelligenz ist es dem Menschen gelungen, den gesamten Planeten innerhalb einer Zeitspanne zu beherrschen, die in galaktischen Maßstäben gemessen lediglich ein Moment ist. Vielleicht können sich einige von Ihnen an eine ausgezeichnete Lügengeschichte von Paul Bunyan erinnnern. Sie gibt genau wieder, worum es sich handelt. Bunyan erzählte, dass es draußen im Westen einen Baum gebe, der so hoch sei, dass ein Mensch sieben Tage brauche, um die Spitze zu sehen. “Sie-ben Menschen können die Spitze jedoch in einem Tag sehen“, erzählte Bunyan weiter. Wenn die Geschichte unseres Sonnen- systems als ein Zeitraum von 24 Stunden dargestellt würde, wäre der Mensch erst um 23:59:30 zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Schauen Sie sich einmal an, was wir in den letzten dreißig Sekunden aus der Erde gemacht haben.
Trotzdem sind die meisten unserer Organisationen primitiv…
Da Organisationen Produkte des Verstands sind, würde man auf jeden Fall erwarten, dass sie sich schneller entwickeln als Systeme wie das des Adlers, das sich genetisch weiterentwickelt. Dies ist wahr. Organisationen entwickeln sich tatsächlich schneller. Relativ gesehen entwickeln sie sich schneller als der Mensch. Organisationen sind jedoch größere und komplexere Systeme als Individuen; gemessen an menschlichen Standards benötigen sie daher viel reelle, chronologische Zeit. Vor dem Hintergrund von 4,5 Milliarden Jahren evolutionärer F & E ist der Mensch physisch nach zwanzig Jahren erwachsen, psychisch weitere zwanzig Jahre später, wenn der Entwicklungsprozess normal verläuft. Eine Organisation ist unter Umständen nach einhundert Jahren noch nicht reif, und der Beginn ihrer Evolution liegt erst 8.000 Jahre zurück. Der Kongress der Vereinigten Staaten ist zweihundert Jahre alt und ganz offensichtlich noch nicht reif. In ihm sind noch immer zahlreiche primitive stammesmäßige Verhaltensweisen zu erkennen. Für den einzelnen ergibt sich daraus das Problem, dass er unter Umständen sein ganzes Arbeitsleben in einer Organisation verbringt, deren Mentalität sich auf der Ebene des Individuums mit der eines Pavians vergleichen lässt. Er erlebt die Organisation möglicherweise nie in einer Entwicklungsstufe, die über diese primitive Stufe hinausgeht. Dies ist besonders für solche Leute frustrierend, die erkennen, welchen Weg die Organisation nehmen könnte, wenn sie ihr Potential einsetzen würde. Es ist auch für diejenigen frustrierend, denen von einer Organisation übel mitge-spielt wird, wie beispielsweise diejenigen, die sich in einer Organisation täuschen und glauben, sie sei weiter entwickelt, als sie es tatsächlich ist.
Primitive Organisationen sind zusammenhanglos…
Was sind die Anzeichen für eine primitive Organisation? Das erste Anzeichen, nach dem man suchen sollte, ist Zusammenhanglosigkeit. Die Zusammenhanglosigkeit tritt dann auf, wenn zwei oder mehr Teile der Organisation geistig oder funktionell nicht in dem Maße zusammengewachsen sind, dass sie, einander ergänzend, für die zukünftigen Ziele des gesamten Systems arbeiten könnten.
In dem Unternehmen, in dem ich tätig war, ist die Personalabteilung nur am Rande mit dem Rest des Unternehmens verbunden. Das Führungspersonal in der Personalabteilung wird an vielen Entscheidungen nicht beteiligt, an denen es beteiligt werden könnte und sollte; von den anderen Abteilungen wird diese Abteilung allgemein als störend empfunden und für unfähig gehalten. Nur ein geringer Teil der in der Personalabteilung vorhandenen Intelligenz wird regelmäßig mobilisiert, um die anderen Abteilungen dabei zu unterstützen, effektiver zu werden. Den meisten Abteilungen ist nicht einmal bewusst, über welche Kapazitäten das Personalwesen verfügt. Ohne dies zu wissen, stempeln sie das Personalwesen als “dumm“ ab.
Verschiedene Bereiche der Organisation verfolgen ähnliche Aufgaben, ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne die Informationen untereinander auszutauschen; so wird oft das Rad ein zweites Mal erfunden. Selbstverständlich – einige der Informationen dringen auch zu den an-deren Bereichen durch, aber es gibt keine formale Struktur oder Ver-fahrensweise, die gewährleisten würde, dass die Erfahrung, die ein Teil des Systems macht, erfasst, organisiert, verarbeitet, an den lnformationsspeicher der Organisation weitergegeben und später wieder aufgerufen wird. Obwohl es sich um eine Computerfirma handelt, verfügt das Unternehmen noch nicht über eigene interne Systeme, mit denen effizient Lernprozesse innerhalb der Organisation implementiert werden können. Hochentwickelte Organisationen führen formale Befragungen in Bezug auf die gewonnenen Erfahrungen durch, werten die Primärintelligenz aus, speichern sie und rufen sie wieder ab, um sie anzuwenden. Bei Weltraumflügen werden beispielsweise umfassende Befragungen durchgeführt, die Ergebnisse analysiert und die Informationen anschließend verbreitet – und selbst dies erfüllt manchmal seinen Zweck nicht.
Primitive Organisationen bilden den Menschen nicht weiter…
Ein anderes Anzeichen für den Grad der Intelligenz einer Organisation ist der Grad, zu dem Information, Schulung und Weiterbildung von Angestellten als wertvoll angesehen werden und regelmäßig zur Verfügung gestellt oder sogar gefordert werden. HighTech-Organisationen, Organisationen der öffentlichen Sicherheit, Gesundheits- und Wohltätigkeitsorganisationen und andere Organisationen, in denen Fehler kaum toleriert werden können, müssen einen beträchtlichen Teil der Bemühungen in der Organisation für Schulung und Weiterbildung verwenden. IBM ist die größte separate Bildungsinstitution der Welt. Dies zeigt sich bereits in der Grundeinstellung. Für Organisationen und auch für Individuen gilt, was Derek Bok, der Präsident der Universität Harvard, sagte: “Wenn Sie der Meinung sind, dass Bildung teuer ist, dann versuchen Sie es doch einmal mit der Ignoranz.“ Wenn in einem System nicht deutlich feststeht, welche Rolle und Funktion die eigene Weiterbildung spielt oder wenn diese Weiterbildung vollständig ignoriert wird, handelt es sich noch immer um ein primitives System.
Primitive Organisationen verfügen über schlechte Kommunikationsmöglichkeiten…
Ebenfalls ein Anzeichen für das Bewusstsein ist der Entwicklungsgrad der Kommunikation. Viele Organisationen, die mit der besten Kommunikations-Hardware ausgestattet sind, haben noch kein offenes Kommunikationssystem entwickelt, in dem ein Informationsfluss nach oben und nach unten erfolgt. Die mit Abstand wertvollste Ressource einer Orga-nisation ist die Denkkraft, d.h., die Intelligenz der Menschen, die ge-sammelt, organisiert, gelenkt und zum Einsatz gebracht wird. Alles andere, einschließlich des Geldes, ist nur eine Nebensache. In einem Klima oder einer Struktur mit geringen Kommunikationsmöglichkeiten ist es jedoch nicht möglich, die menschliche Intelligenz wieder aufzurufen und beständig und wirkungsvoll einzusetzen.
Primitive Organisationen legen keinen Wert auf Rituale…
In der Firma, in der ich gearbeitet habe, wurde der Leiter eines Unternehmensbereichs pensioniert und durch einen anderen ersetzt, ohne dass die betroffenen Mitarbeiter von diesem Wechsel unterrichtet wurden. Wenn er die Firma nicht von Zeit zu Zeit besucht hätte, hätte leicht der Eindruck entstehen können, er würde irgendwo als Geisel gefangengehalten. Kommunikationsfehler dieser Größenordnung treten in einem hochentwickelten System sehr selten auf. Nicht nur, dass ein so bedeutender Führungswechsel in einem hochentwickelten System in angemessener Form mitgeteilt wird, er erfolgt auch nach einem genau festgelegten Ritual. Durch eine bestimmte Zeremonie wird die Übergabe der Leitungsbefugnis symbolisiert und deutlich gemacht. Dieses Ereignis wird gebührend gefeiert und gewürdigt. Jeder einzelne weiß, wer an der Spitze steht und wann die Leitung an einen anderen übergeben wird.
Das Vorhandensein und der Vollzug bestimmter Riten und Mythen ist das Hauptkennzeichen eines hochentwickelten Systems. In seinem Buch “Myths To Live“ macht Joseph Campbell deutlich, dass das Her-vorbringen und Weitergeben von Mythen das bisher wichtigste und bekannteste Zeichen für das Vorhandensein hoher Intelligenz ist. Mythen sind die Grundlage für eine ständige Weiterentwicklung der Lebensformen. Einige Organisationen sind sich dieser Tatsache durchaus bewusst.
Die katholische Kirche beispielsweise. Oder militärische Organisationen. Die meisten Organisationen sind sich dessen aber nicht bewusst. Sie verwechseln Mythos mit Wahnvorstellungen und werfen beides über Bord. So sind beispielsweise Fusionen noch überhaupt nicht in einer angemessenen Form ritualisiert. Eine Veränderung des Firmennamens vielleicht, aber das ist auch schon alles. Das einzige Ergebnis ist oft die Durchdringung und der Abfluss ungelenkter mentaler Energie innerhalb der neuen Organisation – etwas, das eigentlich gut dazu hätte benutzt werden können, den Verschmelzungsprozess zu beschleuni-gen und zu stärken.
Primitive Systeme begehen bewusst Kommunikationsfehler…
Kein intelligentes System begeht bewusst Kommunikationsfehler, es sei denn, diese Kommunikationsfehler oder Falschinformationen sind Teil ihrer Strategie, wie es bei der CIA und anderen Geheimdiensten, deren Aufgabengebiet die nationale Sicherheit ist, der Fall ist. Gerade diese Organisationen verfügen oft über ein ausgeklügeltes und präzises in-ternes Kommunikationssystem. Der lran-Contra-¬Skandal hat gezeigt, dass bewusst begangene Kommunikationsfehler in einer solchen Or-ganisation äußerst gefährlich und bei eine Institutionalisierung für die freie Gesellschaft tödlich sein können. Wenn also eine Organisation Fehler in der Kommunikation begeht, die nicht ausdrücklich oder be-wusst auf strategische Überlegungen zurückzuführen sind, ist dies ein Zeichen dafür, dass sie noch nicht so weit entwickelt ist, dass sie für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden kann.
Primitive Organisationen zeichnen sich durch übersteigerten Männlichkeitswahn oder falsch verstandenen Feminismus aus…
Eines der wichtigsten Kennzeichen für den psychologischen Zustand einer hochentwickelten Organisation ist die Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien. Jung betont, dass der männliche Anteil der Psyche Energie liefert für die Perfektion, und der weibliche Anteil Energie für die Vollendung Ein offensichtliches Paradoxon: Wer nach Perfektion strebt, kann nie etwas vollenden. Wer etwas vollendet will, ist selten perfekt.
Organisationen haben dasselbe fundamentale Paradoxon von Perfek-tion und Vollendung zu bewältigen, aber die Mehrzahl ist von einer dominant männlichen Psyche geprägt. Die meisten Organisationen die-ser Erde wurden von Männern aufgebaut – ob zu ihrem Vorteil mag da-hingestellt sein. Das Ergebnis ist ein Ungleichgewicht zugunsten der männlichen Komponente. Es gibt für eine Organisation keine Möglich-keit sich deutlich über eine primitive Stufe hinaus weiterzuentwickeln, solange dieses Ungleichgewicht nicht beseitigt ist.
Eine Organisation kann sich heutzutage nur weiterentwickeln, wenn auch die weiblichen Prinzipien stärker berücksichtigt werden. Das be-deutet die Integration der Frauen auf allen – insbesondere auch den höchsten – organisatorischen Ebenen. Es geht nicht darum, nett zu den Frauen zu sein oder EG- Richtlinien zu befolgen. Es geht darum, sich anzupassen und zu überleben. Weder die Männer noch die Frauen haben die Weisheit gepachtet. Nur gemeinsam kann die Realität ge-meistert werden.
Wir können uns primitive Organisationen nicht leisten…
Dies sind nur einige wenige Kennzeichen organisatorischer Intelligenz. Es gibt noch andere, deren Berücksichtigung aber den Rahmen eines solchen Vortrags sprengen würden. Die Erforschung der Gesetzmä-ßigkeiten, nach denen sich eine Organisation entwickelt, ist zwar noch eine relativ junge Disziplin, aber es beginnen sich doch Wege abzu-zeichnen, wie sich eine Organisation weiterentwickeln, wie sie lernen und sich selbst verändern kann.
Nicht intelligente, unterentwickelte Organisationen werden zunehmend zu einer internationalen Belastung. Die Welt ist zu klein und die Probleme sind zu groß und zu wichtig, als dass man sich solche Organisationen leisten könnte. Sie können manchmal sehr gefährlich und schädlich sein – das Dritte Reich ist ein Beispiel dafür, auf jeden Fall aber sind sie entwicklungshemmend und destruktiv. In ihrer Entwicklung gehemmte Organisationen können nicht effektiv und effizient funktionieren, sie benötigen enorme Ressourcen an Material und Energie und können ganz einfach die sich ihnen stellenden Herausforderungen nicht bewältigen. Jedem, der sich auch nur halbwegs mit der Materie beschäftigt hat, ist klar, dass Kriege in einer Welt, die so eng miteinander verknüpft ist, keinen Platz mehr haben dürfen. Egoistische Wirtschaftsformen auf Kosten der anderen sind nicht länger tragbar. Krankheiten und Hungersnöte müssen stärker bekämpft werden. Ebenso der saure Regen. Die Liste könnte beinah beliebig fortgesetzt werden.
Organisationen brauchen engagierte Weiterentwicklung…
Organisationen brauchen engagierte, fachkundig Weiterentwicklung, um die übergreifenden Probleme, die nur von Organisationen bewältigt werden können, angehen zu können. Sie sind im Grunde genommen eine Art Weiterentwicklung von uns selbst und der verlängerte Arm unserer Intelligenz, Kreativität und unseres Willens.
Auf eine Organisation gerichteter Ärger und Verdruss – in der Vergangenheit die Regel – führen nur zu Vergeltungsmaßnahmen, der wohl dümmsten Art der Reaktion. Und solange der Organisation keine anderen Wege aufgezeigt werden, wird sie auch nicht anders reagieren. Sie kennt nur den Angriff. Protestbewegungen haben gelernt, auf diese Art Organisationen zu manipulieren. Sie wissen, dass das System mit Angriff auf Angriffe reagieren muß, weil es nie etwas anderes gelernt hat. Dies führt zu Ausschreitungen durch die Sicherheitskräfte und Festnahmen bei den Demonstranten. Am nächsten Tag kann man dann den Zeitungen entnehmen, wie absolut idiotisch sich die Organisation verhalten hat. Wie sonst ist zu erklären, dass Protesten weltweit auf die gleiche Art begegnet wird. Es kann nicht nur an den daran beteiligten Individuen liegen. Sie sind zu unterschiedlich, ihre kulturellen Unter-schiede zu groß, um eine so verblüffende Ähnlichkeit bei der Reaktion von Organisationen erklären zu können.
Wir als Individuen müssen Engagement zeigen…
Gerade wir Individuen müssen als der intelligentere Teil von den beiden existierenden Systemen soviel uneigennütziges Engagement aufbringen und den Organisationen dabei helfen, zu lernen, wie ein zivilisierter Dialog über die bestehenden Unterschiede organisiert und durchgeführt werden kann. Das bedeutet nicht, dass man die Organisationen nicht für ihr Verhalten verantwortlich machen sollte, ganz im Gegenteil. Sie sollten aber nur insofern zur Rechenschaft gezogen werden, als sie die Informationen soweit verarbeiten können, dass sie von ihrem Verhalten lernen und es verändern können. Bisher sind die zur Verfügung stellenden Mechanismen meist juristischer oder ausdrücklich feindlicher Art (wie auch die meisten Zusammenschlüsse) und nicht pädagogischer Art.
Ein erster Anfang ist gemacht. Das Rechtssystem erteilte Texaco eine Lektion in Sachen Vertragserfüllung, die alles andere als feinfühlig und rücksichtsvoll war. Die Regierung der USA erteilte Sunstrand eine $ 198 Mio. teure Lektion in punkto Verschwendung, Betrug und Missbrauch. Diese deutliche Sprache war offensichtlich notwendig. Und gerade darin liegt die Tragödie. Texaco und Sunstrand verstehen offensichtlich keine andere Sprache. Wie sonst ist zu erklären, dass sie ihre lebenswichtige Energie auf solche unwichtigen Streitereien verschwenden. Ein höher entwickeltes System hätte diese Auseinandersetzung wesentlich effektiver und effizienter beigelegt – oder noch besser – gar nicht erst damit begonnen. Wie es scheint, haben beide Organisationen ihre eigenen Ressourcen verschwendet und die ihnen zur Verfügung stehende Energie, die sie eigentlich für Anpassung und Weiterentwicklung einsetzen sollten, sinnlos vergeudet. Beide Organisationen sind jedoch – ebenso wie die große Mehrheit der Organisationen – Teil unseres eigenen Gemeinwesens und deshalb sehr wichtig für uns. Durch sie haben wir einen größeren Einfluss auf den Ablauf der Dinge und können Umwelt und Wirtschaft steuern. Dadurch können wir ein sinnerfülltes und verantwortungsbewusstes Leben führen.
Nur wir können etwas verändern…
Es ist offensichtlich, dass die meisten Organisationen nicht bereit sind, Verantwortung in dem Maße zu übernehmen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich erforderlich wäre. Sie brauchen viel Hilfe – engagierte und verantwortungsbewusste Hilfe. Nur wir können diese Hilfe leisten, weil nur wir wissen worauf es wirklich ankommt und was geleistet werden könnte. Wenn wir jedoch weiterhin glauben, sie seien gerissener als sie wirklich sind, werden wir sie wegen ihrer Dummheit angreifen und weiterhin ihre Paranoia rechtfertigen. Wenn wir uns nicht als Teil von Organisationen betrachten, sondern als ihr Opfer, sagen wir uns von dem los, was wir selbst aufgebaut haben und zerstören uns damit selbst. Es besteht die Gefahr, dass wir gerade dies tun. Wir wissen nicht viel von ihnen, sie sind praktisch Fremde mitten unter uns. Ich behaupte, es liegt in unserem ureigensten Interesse, uns miteinander bekannt zu machen und bald zu Freunden zu werden.
 prasselten die „Unerledigten“ auf mich ein: Der Geschirrspüler läuft noch nicht, es sind mindestens zwei Maschinen Wäsche zu waschen, ich habe heute eine Verabredung in St. Michaelisdonn, die noch nicht final abgestimmt ist, da liegt schon wieder ein Korb Bügelwäsche, die Katzenklos müssen gemacht werden, im Büro liegen ein paar unerledigte Dinge auf dem Schreibtisch, die eine ganz hohe Priorität haben…
prasselten die „Unerledigten“ auf mich ein: Der Geschirrspüler läuft noch nicht, es sind mindestens zwei Maschinen Wäsche zu waschen, ich habe heute eine Verabredung in St. Michaelisdonn, die noch nicht final abgestimmt ist, da liegt schon wieder ein Korb Bügelwäsche, die Katzenklos müssen gemacht werden, im Büro liegen ein paar unerledigte Dinge auf dem Schreibtisch, die eine ganz hohe Priorität haben… Und dann könnte ich mithilfe des Zauberstabs all diese Antreibungen und Hetzereien abfließen lassen. Es ist ja nicht das, was es ist, was mich antreibt. Es sind meine Gedanken dazu. Der Bügelkorb steht friedlich im Schrank und sagt kein Wort. Die Waschmaschine beschwert sich ebenfalls nicht über mangelnde Ladung. Noch ist Geschirr im Schrank, ich stehe also nicht weinend vor schmutzigen Kaffeetassen. Ok, die Katzen neigen irgendwann zu Protesthandlungen, wenn ihre Klos nicht geputzt sind, aber auch an dieser „Front“ besteht keine Lebensgefahr. Ich bin heute nicht im Büro, und ich habe diese Woche ohnehin 50 Stunden auf der Uhr – also was will ich mich verrückt machen über das, was da unerledigt liegt, heute, am Sonntag…
Und dann könnte ich mithilfe des Zauberstabs all diese Antreibungen und Hetzereien abfließen lassen. Es ist ja nicht das, was es ist, was mich antreibt. Es sind meine Gedanken dazu. Der Bügelkorb steht friedlich im Schrank und sagt kein Wort. Die Waschmaschine beschwert sich ebenfalls nicht über mangelnde Ladung. Noch ist Geschirr im Schrank, ich stehe also nicht weinend vor schmutzigen Kaffeetassen. Ok, die Katzen neigen irgendwann zu Protesthandlungen, wenn ihre Klos nicht geputzt sind, aber auch an dieser „Front“ besteht keine Lebensgefahr. Ich bin heute nicht im Büro, und ich habe diese Woche ohnehin 50 Stunden auf der Uhr – also was will ich mich verrückt machen über das, was da unerledigt liegt, heute, am Sonntag…