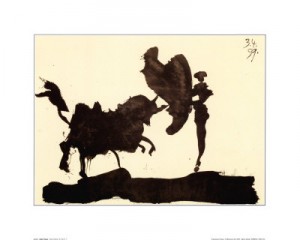Wortschätzchen: ausbooten
Hallo, Welt!
Ist es nicht wunderbar, wie viele verschiedene Worte es gibt und wie fein nuanciert wir uns damit ausdrücken können? Nach wie vor gibt es Wortschätzchen, die mir besondere Freude machen, weil sie das Gehirn in Schwung bringen und uns einladen, über die genaue Bedeutung dessen, was gerade gesagt wird, nachzudenken.
Vor mir liegt das Maritime Wörterbuch von Jürgen Gebauer und Egon Krenz (1989). Meine Erwartung war, zum Stichwort ausbooten einen längeren Passus zu finden. Aber hier steht auf Seite 23 lediglich: ausbooten: etwas mit Booten an Land bringen.
Da ist das Bild in meinem Kopf zum Thema ausbooten doch wesentlich bunter. Ich sehe vor meinem inneren Auge die Börteboote, die in Helgoland die Tagesgäste von den Ausflugsdampfern abholen und an Land bringen. Und ich sehe Käpt’n Jack Sparrow, der von der Crew der Black Pearl auf einer einsamen Karibik-Insel abgesetzt wird.
Ausgebootet werden also Menschen und Waren. Sie kommen runter vom Schiff, werden an Land geschafft. Eigentlich eine nüchterne Beschreibung eines Vorgangs. Doch als ich Montag hörte, „ich fühle mich ausgebootet“, entstand in meinem Kopf kein Bild davon, wie jemand in einem lustigen Kahn an Land gerudert wurde. Mit allen Sinnen nahm ich wahr, dass die Botschaft eine andere war: Gegen meinen Willen bin ich nicht mehr Teil der Mannschaft.
Was könnten also die Gefühle sein, die in jemandem lebendig sind, der von sich selbst sagt: „Ich fühle mich ausgebootet!“?
ängstlich
ärgerlich
aufgeregt
bestürzt
betroffen
bitter
durcheinander
einsam
empört/entrüstet
frustriert (?)
hilflos
in Panik (?)
im Schmerz
perplex (wenn das Geschehen überraschend kommt)
traurig
sauer
schockiert
streitlustig
überwältigt
unter Druck
verstört
verzweifelt
widerwillig
wütend
zornig
Mir kommt es so vor, als ob die Gefühle in zwei Oberkategorien passen: Wut und Angst.
Und welche Bedürfnisse sind bei mir im Mangel, wenn ich sage, ich fühle mich ausgebootet?
Als erstes springt mich
Gemeinschaft an. Die Gemeinschaft ist an Bord, ich werde weggebracht, gegen meinen Willen. Ich möchte Teil der Gemeinschaft sein, aber andere entscheiden, dass ich das Schiff verlassen muss. Aber mir fallen auch noch ein paar andere wunderbare Bedürfnisse ein:
Sicherheit
Schutz
Autonomie
Selbstvertrauen
Integrität
Beteiligung
Zugehörigkeit
Vertrauen
Geborgenheit
Gesehen/gehört werden
Harmonie
Auch hier zeigen sich für mich zwei Schwerpunkte. Das eine ist der Aspekt, nicht mehr Teil der Gemeinschaft zu sein mit allen Facetten, der andere Aspekt rührt an Autonomie und Freiheit meiner Entscheidung.
Nicht zu vergessen: ausgebootet ist ein Interpretationsgefühl. Es stammt nicht aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit, um sich mit den dahinter liegenden Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden.
So long!
Ysabelle